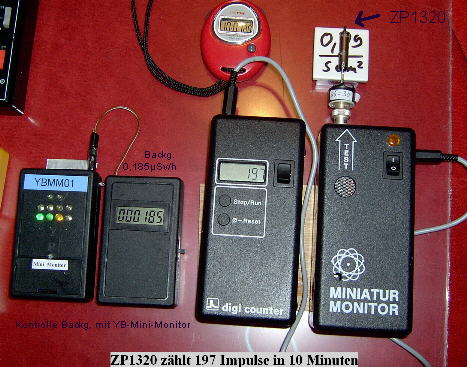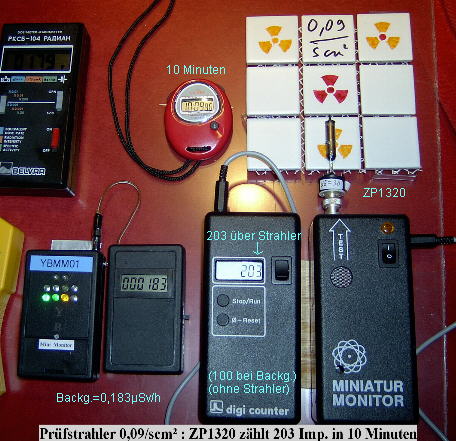Alpha-Beta-Gamma
radioaktive Strahlung
Seite 2
Messungen an verschiedenen Prüfstrahlern
mit ZP1320
natürlich mag ich nicht ständig die auf der vorausgegangenen Seite vorgestellte fliegende Verdrahtung
mit externer Hochspannungsquelle, Messverstärker und
Hochfrequenzzähler an die Röhre anschliessen und mit mir herumtragen.
Also werden die nächsten Messungen mal zwischendurch wieder mit der üblichen Gerätschaft durchgeführt.
Und zwar an Prüfstrahlern, die sich auch mit der ungeschützten Hand mal anfassen
lassen. Aber bitte möglichst nicht gleich die ganzen Wände in
der Wohnung mit Prüfstrahlern auslegen.
Die Messgeräte zeigen aufgrund der
Umgebungsstrahlung (Gamma-Backgr.) einen "Nulleffekt", der zuerst
festgestellt und später vom Messwert abgezogen werden muss.
Gamma Backgr. ungeschirmt ist bei allen den folgenden
Bildern ein Wert zwischen 0,15µSv/h bis 0,2µSv/h. (München Stadtrandgebiet) Eine
Bleiburg die den Backg. schirmt habe ich mir mal nicht ins Zimmer
gewuchtet. Am End bricht mir das Haus zusammen von dem Gewicht...
In einem ersten Vorversuch wird der Nulleffekt auch mit der ZP1320 und
dem "digi counter" bestimmt. Die am "digi counter " von der ZP1320
gezählten Impulszahl im Nulleffekt wird dann von den Messwerten
die sich aus allen weiteren Versuchen mit der ZP1320 und dem digi
counter ergeben, abgezogen.
Bei rund gerechnet 0,17µSv/h Gamma Backgr. hat mir die ZP1320 etwa 100 Imp. in 10 Minuten mit dem "digi counter" gezählt.
Diese 100 Impulse werden dann von allen weiteren ZP1320 Zählergebnissen abgezogen.
Nachdem 100 Impulse in 10 Minuten am "digi counter"
bei Backgr.ohne Strahler festgehalten sind, folgt nun
Zählung mit dem "digi counter"
über kleinem Prüfstrahler bei kürzestem Abstand. Links
neben dem "digi counter" ist der YB-Mini-Monitor zu sehen, welcher zu
jedem Versuch parallel eine Kontrolle des Backgr. in der
Messeinheit µSv/h gestattet.
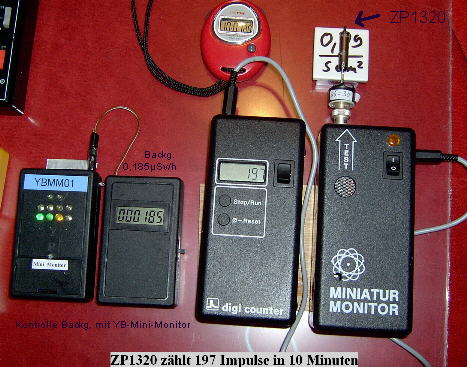
Bild1
Die ZP1320 zählt etwa 200 Impulse in 10 Minuten an dem kleinen Prüfstrahler
100 Impulse Backg. sind hier noch nicht abgezogen.
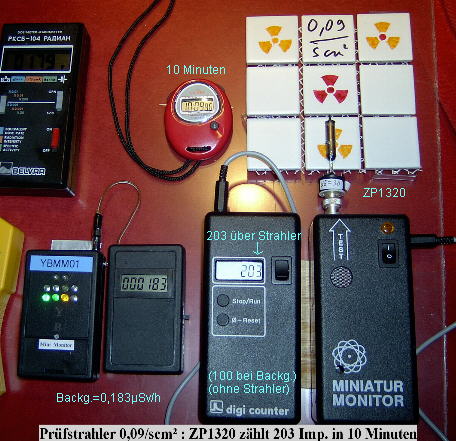
Bild2
An dem grossen Prüfstrahler etwa das gleiche Messergebnis:
90 Impulse in 10 Minuten nach Abzug des Backg. entspricht 0,09/scm²
rund gerechnet :
Diese Messungen an den Prüfstrahlern haben mir also folgendes gezeigt:
100 Impulse (Backg. schon abgezogen) in 10 Minuten mit der ZP1320 gemessen entspricht etwa 0,1/scm²
Praktisch gesehen wurde auf diese Weise die Messvorrichtung mit Hilfe des Prüfstrahlers kalibriert.
Nun zum Vergleich Messung an 10g KCl in dünnwandigem Plastikbeutel.
10g KCl auf ca. 20cm² zusammengeschoben, gleichmässig
verteilt und im dünnwandigen Plastikbeutelchen flach gepresst.

Bild3 : 10g KCl ...696 Imp. gemessen mit der ZP1320 kürzester Abstand
100 Imp. Backg. abziehen
ergibt rund 600 Impulse in 10 Minuten.
also 1 Impuls/s oder 0,6/scm²
Nun lässt sich rechnen:
laut Literatur gilt:
10g KCl entwickeln eine Aktivität von 180 Bq (Literatur)
90Bq gehen von der Vorderseite des Strahlers aus und weitere
90Bq von der Rückseite macht zusammen 180 Bq.
Da die Strahleroberfläche 20cm² beträgt, ergibt das rechnerisch 4,5Bq/cm² .
Ooops das ist fast 10 mal so viel, als gemessen wurde. :-( Stimmt etwa die Kalibrierung nicht ?
Es steht glücklicherweise ein frisch kalibrierter LB1210 im
Schrank Flugs den kleinen KCl Strahler unter die 100cm²
grosse Messfläche gelegt. Der LB1210 erfasst mit der grossen
Messfläche ganz sicher alle Teilchen, die von dem Srahler ausgehen.
Siehe da: Ein LB1210 zeigt nach Abzug des Backg. etwa 10 Impulse pro
Sekunde in kürzestem Abstand über dem kleinen KCl-Strahler.
10 Impulse pro Sekunde in kürzestem Abstand über diesen
20cm² das sind 0,5/scm² gemessene Teilchenflussdichte.
Dieses mit dem LB1210 gemessene Ergebnis stimmt recht gut mit den
Ergebnissen aus der oben in den Bild3 gezeigten Messergebnis
(0,6/scm²)überein
Zugegeben ist der verwendete kleine
KCl-Strahler etwas
provisorisch und klein. Besser wäre es einen KCl-Strahler mit
einer aktiv
strahlenden Fläche einzusetzen, welche grösser ist als die
aktive
Zählrohrfläche der eingesetzten Messgeräte. Für den
LB1210 ist dieser provisorische KCL -Strahler etwas klein geraten. Also
muss bei nächster Gelegenheit mal ein richtig grosser KCl Strahler
her.
Doch schon jetzt zeichnet sich ab, das sich ein Geigerzähler sehr
gut mittels der hier eingesetzten keramischen Prüfstrahler
kalibrieren läst. Der Unterschied bei den Messungen mit der kleinen Röhre im Vergleich mit der grossen Zählrohrfläche des LB1210
vornehmlich in der Messzeitspanne liegt. Während der
Berthold das Messergebnis recht gut innerhalb von 1 Minute schon
anzeigt, muss mit der ZP1320 mind. 10 Minuten lang gemessen werden um
einen brauchbaren Zählwert zu erhalten.
Dann ist noch zu beachten :
gemessen wurden mit zwei unabhängigen Messvorrichtungen
übereinstimmend etwa 0,5/scm² an dem kleinen KCl Strahler.
Rechnerisch ergeben sich jedoch etwa 5 Bq/cm².
Diesen Unterschied führe ich auf verschedene Effekte
zurück. Einmal lässt die Geometrie des kleinen KCl-Beutelchen
aufgrund von Absorbtioneffekten in der KCl-Schicht nicht zu, das alle
Quanten an die Oberfläche gelangen. Weiterhin ist eine von 1
verschiedene Ansprechwahrscheinlichkeit der Zählröhre zu
berücksichtigen. Ich
nehme mal an, das auf die Literaturangabe 180Bq/10g KCl in diesem
Falle Verlass ist.
Bei den in diesen Versuchen eigesetzten Zählern
handelt es sich zudem weitgehend um profesionell gefertigte
Messgeräte. Anhand dieser Überlegungen in Zusammenhang
mit den beschriebenen Beobachtungen (Messergebnissen) ergibt sich
für mich die Folgerung: Es wird nur etwa jedes 10te
Quant welches von der Gesamtmenge=10g KCl in Sensorrichtung ausgeht,
zur Anzeige gebracht.
Die anhand der Prüfstrahler vorgenommene Kalibrierung in
1/scm² welche eine direkte Messung der Teilchenflussdichte an
der Strahleroberfläche gestattet, ist jedoch stimmig !
Aus diesem Zusammenhang heraus unterschiede ich zwischen der sog.
Teilchenflussdichte in 1/scm² welche sich direkt vom Detektor
erzeugten Zählergebnis ableitet , bezogen auf ein bestimmtes
Nuklid. Im Unterschied
dazu ist mit Quantenflussdichte in Bq/cm² die direkt von einer
Strahleroberfläche
ausgehende Strahlung gemeint, welche durch Zerfall eines in der
Regel bekannten Nuklids entsteht.
Es kann in diesem Sinne die
Quantenflussdichte als Eingangssignal gesehen werden. Angeschlossen ist
der Prozess, welcher den Weg der Quanten vom Strahler bis zur Röhre, sowie die
Röhre und den
Messverstärker (evtl. mit mit elektronischer Signalfilterung)
beinhaltet. Der Prozess G sei beschreibbar durch eine
Übertragungsfunktion G(t) . Das Ausgangssignal kann ein
Analogsignal oder beispielsweise auch ein digitales Zählergebnis
sein. Dann sind evtl. vorhandene
Störeffekte zu berücksichtigen. Diese Modellvorstellung
erläutert
das nächste Bild.
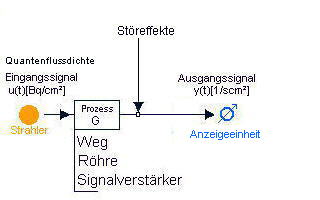
Bild4 : Radioaktive Messtechnik , einfache Modellvorstellung der Signalübertragung vom Strahler bis zur Anzeigeeinheit.
Dies ist als einer meiner ersten
persönlichen
Modellvorstellungen bezüglich dieser Thematik zu sehen,
welche aufgrund der vorangegangenen wenig präzisen Art der Messung
für mich vorerst einen orientierenden Charakter hat.
Grundsätzlich nehme ich an, es sollte eine Messanordnung realisierbar sein, deren
Prozessübertragungsfunktion G(t)= 1 sehr nahe kommt,
so das ein weitgehend direktes
Messergebnis in Bq/cm² möglich wird, egal welche(s) Nuklid(e) sich in der Probe befindet.
Fortsetzung folgt....
<---
Seite zurück
nächste
Seite -->
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literaturhinweise
:
a) Experimente mit selbstgebauten Geigerzählern, Funken- &
Nebelkammern Grundlagen und Praxis der radioaktiven Messtechnik ,Thomas
Rapp, Franzis Verlag 2008
b)
Identifikation dynamischer Systeme, Digitale Regelsysteme , Rolf Isermann, Springer
Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris 1987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chetan Reinhard
Josephsburgstr. 38
81673 München
Tel.:089-432703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------